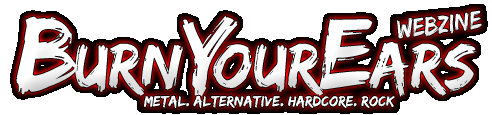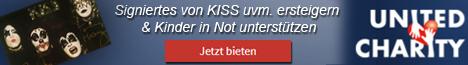Ich habe die Musik von Paradise Lost einst so sehr geliebt, dass ich mir das Dornen-Bandlogo auf den Arm tätowieren lassen wollte. Das war Anfang/Mitte der Neunziger, als ich durch Alben wie "Shades Of God", "Icon" und "Draconian Times" komplett in den Bann der britischen Band gezogen wurde, die 1991 mit "Gothic" das Fundament für ein ganzes Metal-Genre legte. Heute bin ich froh, dass keine Tätowiernadel meinen Arm berührt hat, denn die letzten drei Alben von Paradise Lost kann man im großen und ganzen ausblenden – das, wofür Paradise Lost einst standen, war in der Musik nur noch selten zu finden: Depressive Härte und schleppende Melancholie vor dem Hintergrund beängstigender Intensität.
„Forever After“, die Single des aktuellen selbstbetitelten Werks, hat mich ein weiteres Mal abgeturnt. Fader Düstermetal, "Schema F" ohne Biss. Das ließ nichts Gutes ahnen, zudem waren auch wieder Produzent Rhys Fulber und Mixer Greg Reely mit von der Partie. Und siehe, auch der erste Durchlauf des Gesamtwerks „Paradise Lost“ zündete nicht. Der zweite nicht. Der dritte schon eher. Und als ich das Album schließlich über Kopfhörer auf einer langen Zugfahrt gehört habe, legte sich der Hebel schließlich doch um.
Natürlich klingt dieses zehnte Album, das nicht mehr mit Lee Morris sondern Ersatzdrummer Jeff Singer in Lincolshire und Los Angeles eingespielt wurde, nicht nach Auferstehung und beherbergt auch schwächere Nummern. Doch aus einem bloßen Rückblick ist mehr geworden, eine Drehung des gesamten Körpers zu den Wurzeln. Langsam schreitet man den Parallelpfad zu den alten Tugenden zurück, passiert die unterwegs verloren gegangenen Stärken und sammelt sie wieder ein. Will heißen: Paradise Lost klingen noch etwas zu glatt und produziert, aber die Riffs rocken wieder und stehen im Vordergrund des hier endlich wieder seinen Namen verdienenden Dark Metals.
Die Anzahl der einst dominierenden elektronischen Spielereien wurde endlich auf ein songdienliches Minimum begrenzt. Holmes und seine Mannen sind zwar nicht von ihrem Schema „harter Refrain und gemächlicher Strophenteil“ abgewichen, jedoch wieder ein Stück weit unvorhersehbar geworden. Und das Wichtigste: Die Traurigkeit berührt wieder, man spürt erneut die Intensität der Musik, das alte und so lang vermisste Feeling stellt sich wieder ein. Nicht auf Anhieb, jedoch mit jeder Umdrehung ein wenig mehr.
Es ist Zeit, Paradise Lost erneut zuzuhören. Sie haben es sich nach langer Zeit endlich wieder verdient.